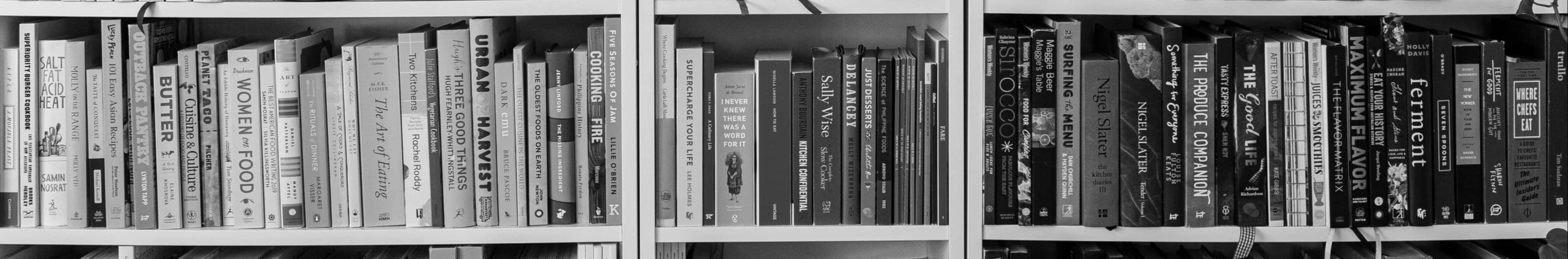Für Studierende, Forschende und Wissenschaftler ist der Zugang zu aktuellen und qualitativ hochwertigen Fachinformationen unerlässlich. Wissenschaftliche Datenbanken bilden dabei das Rückgrat jeder fundierten Recherche. Sie ermöglichen den systematischen Zugriff auf Fachpublikationen, Forschungsergebnisse und Primärquellen aus verschiedensten Disziplinen. Dieser Artikel stellt die wichtigsten wissenschaftlichen Datenbanken vor, erläutert ihre Besonderheiten und hilft dir, die für deine Recherche optimale Datenbank zu finden.
Was sind wissenschaftliche Datenbanken?
Wissenschaftliche Datenbanken sind spezialisierte digitale Sammlungen, die Zugang zu Fachliteratur und Forschungsinhalten bieten. Im Gegensatz zu allgemeinen Suchmaschinen wie Google durchsuchen sie gezielt akademische Quellen und gewährleisten dadurch eine höhere Qualität und Relevanz der Ergebnisse. Typischerweise enthalten sie:
- Fachartikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften
- Konferenzberichte und -beiträge
- Dissertationen und Abschlussarbeiten
- Forschungsberichte und Working Papers
- Bücher und E-Books
- Primärquellen und Forschungsdaten
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen bibliografischen Datenbanken, die hauptsächlich Metadaten und Nachweise enthalten, und Volltextdatenbanken, die direkten Zugriff auf die kompletten Publikationen bieten.
Die wichtigsten multidisziplinären Datenbanken
Scopus
Scopus, betrieben vom Wissenschaftsverlag Elsevier, zählt zu den umfangreichsten bibliografischen Datenbanken weltweit. Mit über 85 Millionen Einträgen und mehr als 24.900 aktiven Zeitschriftentiteln deckt sie nahezu alle Wissenschaftsdisziplinen ab.
Besonderheiten:
- Umfangreiche Zitationsanalyse-Werkzeuge
- Hohe Qualitätskontrolle durch ein unabhängiges Expertengremium
- Ausgezeichnete Metadatenqualität
- Journal-Metriken wie CiteScore und SCImago Journal Rank
- Autor-Metriken wie der h-Index
Vorteile: Sehr umfassende Abdeckung, präzise Suchmöglichkeiten, exzellente Metadatenqualität, integrierte Analysetools Nachteile: Kostenpflichtig, Zugang meist nur über Institutionen möglich
Web of Science
Web of Science (WoS) ist eine der ältesten und renommiertesten wissenschaftlichen Datenbanken. Sie zeichnet sich durch eine strenge Qualitätskontrolle und exzellente Zitationsanalyse aus.
Besonderheiten:
- Fokus auf hochwertige, peer-reviewte Zeitschriften
- Umfangreiche Zitationsanalysen
- Sehr gutes Citation Tracking
- Präzise Suchergebnisse mit wenigen irrelevanten Treffern
- Ausgezeichnete Verschlagwortung
Vorteile: Hohe Datenqualität, exzellente Filtermöglichkeiten, präzise Suchergebnisse Nachteile: Weniger umfassend bei Büchern und Konferenzschriften, kostenpflichtig, stärkerer Fokus auf Naturwissenschaften als auf Geisteswissenschaften
EBSCO
EBSCO bietet mit der EBSCOhost-Plattform eine der größten multidisziplinären Datenbanken für wissenschaftliche Webressourcen mit mehr als 36 fachspezifischen Teilbereichen.
Besonderheiten:
- Besonders stark in Soziologie, Politologie, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie
- Breites Spektrum an Publikationstypen (Working Papers, Reports, Konferenzberichte)
- Disziplinspezifische Thesauri und Schlagwörter für präzisere Suchen
- Integration von Open-Access-Zeitschriften
Vorteile: Exzellente fachspezifische Suchfunktionen, breite Abdeckung verschiedener Publikationstypen, gute Verfügbarkeit in Bibliotheken Nachteile: Kompliziertere Benutzeroberfläche, Zugang meist kostenpflichtig
JSTOR
JSTOR (Journal Storage) ist ein digitales Archiv, das sich besonders durch seine historische Tiefe auszeichnet. Die Datenbank bietet Zugriff auf vollständige Zeitschriftenarchive, die teilweise bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen.
Besonderheiten:
- Digitalisierte Zeitschriften von Band 1 an
- Aktuellste Jahrgänge meist durch eine "Moving Wall" von 3-5 Jahren gesperrt
- Hochwertige Volltexte im PDF-Format
- Besonders stark in Geistes- und Sozialwissenschaften
Vorteile: Historische Tiefe, hohe Scan-Qualität, einfache Benutzeroberfläche Nachteile: Eingeschränkter Zugang zu aktuellen Publikationen, Zugang meist kostenpflichtig
ProQuest
ProQuest bietet eine umfangreiche Sammlung von Datenbanken mit Zeitschriften, Dissertationen, Zeitungen, Büchern und anderen Quellen.
Besonderheiten:
- Besonders umfangreiche Sammlung von Dissertationen und Abschlussarbeiten
- Starke Abdeckung von Primärquellen
- Multidisziplinäre Ausrichtung mit Schwerpunkt auf Sozial- und Geisteswissenschaften
- Vielfältige Export- und Zitationsfunktionen
Vorteile: Breites Spektrum an Quellentypen, gute Exportmöglichkeiten, umfangreiche Sammlung grauer Literatur Nachteile: Kostenpflichtig, teilweise komplexe Suchoberfläche
Kostenfreie wissenschaftliche Suchmaschinen
Google Scholar
Google Scholar ist eine spezialisierte Suchmaschine für wissenschaftliche Literatur aller Fachrichtungen. Sie ist kostenlos zugänglich und bietet eine einfache Benutzeroberfläche.
Besonderheiten:
- Einfache Bedienung ähnlich der Google-Suche
- Breite Abdeckung verschiedener Quellentypen
- Zitationsanalyse und Verfolgung von Zitationen
- "Verwandte Artikel"-Funktion
- Erkennung verschiedener Versionen desselben Dokuments
Vorteile: Kostenlos, einfache Bedienung, großer Umfang, gute Verfügbarkeitsanzeige Nachteile: Geringere Metadatenqualität, weniger präzise Filtermöglichkeiten, keine Qualitätskontrolle der indexierten Quellen
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
BASE ist eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Web-Dokumente und wird von der Universitätsbibliothek Bielefeld betrieben. Sie fokussiert sich besonders auf Open-Access-Inhalte.
Besonderheiten:
- Über 400 Millionen Nachweise von mehr als 11.000 Datenquellen
- Etwa 60% der indexierten Nachweise sind frei zugänglich (Open Access)
- Intellektuelle Auswahl und Prüfung aller durchsuchten Quellen
- Hohe Metadatenqualität
- Integration mit Google Scholar
Vorteile: Kostenlos, hohe Datenqualität, Fokus auf Open Access, transparentes Quellenverzeichnis Nachteile: Weniger bekannt, meist nur Metadaten und nicht die kompletten Volltexte indexiert
PubMed
PubMed ist die wichtigste kostenfreie Datenbank für biomedizinische Literatur. Sie wird von der National Library of Medicine in den USA betrieben.
Besonderheiten:
- Über 34 Millionen Zitationen und Abstracts
- Spezialisiert auf Medizin, Biologie und angrenzende Lebenswissenschaften
- Verknüpfung mit klinischen Studien und genetischen Datenbanken
- Standardsuchfunktion für medizinische Systematische Reviews
Vorteile: Kostenlos, hohe Fachspezifität, integrierte MeSH-Verschlagwortung, umfangreiches Schulungsmaterial Nachteile: Fokus nur auf medizinische und biomedizinische Fachgebiete, nicht alle indexierten Artikel sind im Volltext verfügbar
Fachspezifische Datenbanken
Neben den multidisziplinären Datenbanken gibt es zahlreiche hochspezialisierte Fachdatenbanken, die für einzelne Wissenschaftsbereiche besonders relevant sind:
Wirtschaftswissenschaften:
- EconBiz und WISO (deutschsprachig)
- EconLit
- Business Source Premier (Teil von EBSCO)
Rechtswissenschaften:
- Beck-Online
- Juris
- LexisNexis
Medizin und Gesundheitswissenschaften:
- MEDLINE/PubMed
- Cochrane Library
- EMBASE
Sozial- und Geisteswissenschaften:
- PsycINFO (Psychologie)
- MLA International Bibliography (Linguistik, Literaturwissenschaft)
- Sociological Abstracts
Naturwissenschaften und Technik:
- SciFinder (Chemie)
- IEEE Xplore (Elektrotechnik, Informatik)
- MathSciNet (Mathematik)
Strategien für effektive Datenbankrecherchen
Um das Beste aus wissenschaftlichen Datenbanken herauszuholen, solltest du folgende Tipps beachten:
Kombiniere verschiedene Datenbanken: Keine Datenbank deckt alle Publikationen ab. Nutze für umfassende Recherchen mehrere Datenbanken.
Lerne die Suchsyntax: Jede Datenbank hat ihre eigenen Suchoperatoren und -funktionen. Investiere Zeit, um die erweiterten Suchfunktionen zu verstehen.
Nutze Thesauri und kontrolliertes Vokabular: Viele Fachdatenbanken verwenden standardisierte Begriffe zur Indexierung. Diese liefern oft präzisere Ergebnisse als Freitextsuchen.
Setze Filter gezielt ein: Nutze Einschränkungen nach Erscheinungsjahr, Dokumenttyp oder Peer-Review-Status, um relevante Ergebnisse zu erhalten.
Verfolge Zitationen: Die Analyse von Zitationsnetzwerken kann zu weiteren relevanten Publikationen führen – sowohl zu älteren Grundlagenwerken als auch zu neueren Weiterentwicklungen.
Nutze Bibliotheksanbindungen: Viele Hochschulbibliotheken bieten direkten Zugang zu kostenpflichtigen Datenbanken und entsprechende Schulungen an.
Tipps zum Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken
Die meisten umfassenden Fachdatenbanken sind kostenpflichtig und werden hauptsächlich über Institutionen wie Universitäten oder Forschungseinrichtungen lizenziert. Als Studierender oder Wissenschaftler hast du daher folgende Zugangsmöglichkeiten:
Über deine Hochschule: Fast alle Universitäten und Hochschulen bieten ihren Angehörigen Zugang zu einer Auswahl wichtiger Datenbanken.
VPN-Verbindung: Oft kannst du über einen VPN-Zugang deiner Hochschule auch von zuhause auf lizenzierte Datenbanken zugreifen.
Gastnutzung in Bibliotheken: Viele wissenschaftliche Bibliotheken ermöglichen auch externen Besuchern die Nutzung ihrer elektronischen Ressourcen vor Ort.
Open-Access-Alternativen: Nutze kostenfreie Alternativen wie BASE, Google Scholar oder fachspezifische Open-Access-Repositorien.
Dokumentlieferdienste: Für einzelne Artikel können Dokumentlieferdienste wie Subito eine kostengünstige Alternative sein.
Fazit
Wissenschaftliche Datenbanken sind unverzichtbare Werkzeuge für fundierte akademische Recherchen. Die Wahl der passenden Datenbank hängt stark von deinem Fachgebiet, deinen spezifischen Anforderungen und deinem verfügbaren Zugang ab. Während kostenpflichtige Angebote wie Scopus und Web of Science oft die umfassendsten und qualitativ hochwertigsten Ergebnisse liefern, bieten kostenfreie Alternativen wie Google Scholar und BASE ebenfalls wertvolle Recherchemöglichkeiten.
Eine optimale Suchstrategie kombiniert verschiedene Datenbanken, nutzt deren spezifische Stärken und bezieht sowohl multidisziplinäre als auch fachspezifische Ressourcen ein. Mit den in diesem Artikel vorgestellten Datenbanken und Recherchetipps bist du bestens gerüstet, um wissenschaftliche Informationen systematisch zu finden und für deine akademische Arbeit zu nutzen.