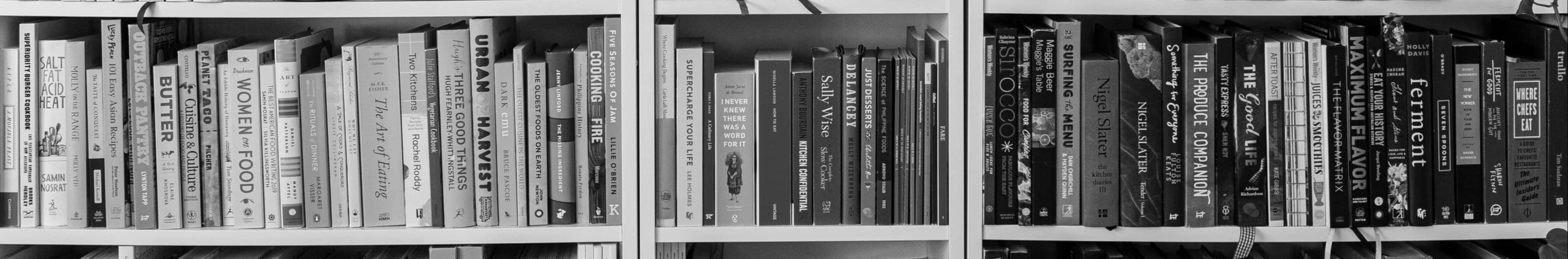Immer mehr Hochschulen und Universitäten legen Wert auf eine geschlechtergerechte Ausdrucksweise in wissenschaftlichen Arbeiten. Doch wie setzt man gendergerechte Sprache in einer Masterarbeit sinnvoll und lesbar um? Dieser Artikel zeigt praktische Möglichkeiten und gibt Orientierung für Studierende im Abschlussprozess.
Warum gendergerechte Sprache in der Wissenschaft?
Sprache prägt unser Denken und unsere Wahrnehmung der Realität. In der Wissenschaft geht es um Präzision und Genauigkeit – auch in der sprachlichen Darstellung. Wenn wir ausschließlich männliche Bezeichnungen verwenden, werden andere Geschlechter sprachlich unsichtbar gemacht, obwohl sie Teil der beschriebenen Gruppe sind.
Die gendergerechte Sprache trägt dazu bei, alle Menschen einzuschließen und sichtbar zu machen. Sie reflektiert die gesellschaftliche Vielfalt und entspricht dem wissenschaftlichen Anspruch an Genauigkeit und Fairness.
Verschiedene Methoden im Überblick
Es gibt mehrere Ansätze, um gendergerecht zu formulieren. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile, die bei der Wahl für Ihre Masterarbeit berücksichtigt werden sollten.
Paarformen
Die Verwendung von weiblicher und männlicher Form ist eine klassische Variante:
- "Die Studentinnen und Studenten nahmen an der Studie teil."
- "Die Professorinnen und Professoren bewerteten die Arbeiten."
Diese Methode ist sehr deutlich, kann aber bei häufiger Anwendung den Text verlängern und den Lesefluss beeinträchtigen.
Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich
Neuere Formen wie der Genderstern (*), der Doppelpunkt (:) oder der Unterstrich (_) schließen auch nicht-binäre Geschlechtsidentitäten ein:
- "Die Student*innen erreichten überdurchschnittliche Ergebnisse."
- "Die Professor:innen publizierten ihre Forschungsergebnisse."
- "Die Teilnehmer_innen füllten den Fragebogen aus."
Diese Varianten sind inklusiv, werden aber von einigen Prüfungsämtern noch nicht akzeptiert.
Neutralisierung
Eine elegante Lösung ist oft die geschlechtsneutrale Formulierung:
- "Die Studierenden" (statt "die Studentinnen und Studenten")
- "Die Lehrenden" (statt "die Lehrerinnen und Lehrer")
- "Die Forschenden" (statt "die Forscherinnen und Forscher")
Diese Methode ist platzsparend und inklusiv zugleich.
Die Vorgaben Ihrer Hochschule beachten
Bevor Sie sich für eine Form der gendergerechten Sprache entscheiden, informieren Sie sich unbedingt über die Richtlinien Ihrer Hochschule. Manche Institutionen haben klare Vorgaben, andere überlassen die Entscheidung den Studierenden, erwarten aber eine konsequente Anwendung der gewählten Methode.
Besprechen Sie Ihre Vorgehensweise im Zweifel mit Ihrer Betreuungsperson. Ein kurzer Hinweis in der Einleitung kann zudem verdeutlichen, nach welchem System Sie gendergerechte Formulierungen verwenden.
Fachspezifische Besonderheiten
In manchen Fachbereichen haben sich bestimmte Konventionen durchgesetzt. In juristischen Arbeiten wird beispielsweise häufig mit Fußnoten gearbeitet, die klarstellen, dass bei männlichen Bezeichnungen alle Geschlechter gemeint sind. Diese Vorgehensweise ist jedoch zunehmend umstritten.
Praktische Tipps für flüssiges Schreiben
Die Integration gendergerechter Sprache sollte den Lesefluss möglichst wenig beeinträchtigen. Hier einige praktische Tipps:
Variieren Sie die Methoden: Verwenden Sie mal Paarformen, mal neutrale Bezeichnungen.
Nutzen Sie Pluralformen: "Die Teilnehmenden" liest sich oft flüssiger als "der/die Teilnehmer*in".
Umformulieren Sie aktiv: Anstatt "Jeder Forscher muss beachten..." können Sie schreiben "Bei der Forschung muss beachtet werden..."
Verwenden Sie direkte Anreden: "Bitte füllen Sie das Formular aus" statt "Der Antragsteller muss das Formular ausfüllen".
Herausforderungen meistern
Die Umstellung auf gendergerechte Formulierungen kann anfangs herausfordernd sein. Nehmen Sie sich Zeit, verschiedene Varianten auszuprobieren. Hilfreich ist es, den Text nach der Fertigstellung gezielt auf sprachliche Geschlechtergerechtigkeit zu prüfen.
Besonders anspruchsvoll wird es bei feststehenden Begriffen oder Zitaten. Hier gilt: Zitate werden nicht verändert, auch wenn sie nicht gendergerecht formuliert sind. Bei Fachbegriffen können Sie beim ersten Auftreten in einer Fußnote erläutern, dass alle Geschlechter gemeint sind.
Vorteile für Ihre wissenschaftliche Arbeit
Die bewusste Verwendung gendergerechter Sprache zeigt nicht nur Ihre Sensibilität für gesellschaftliche Themen, sondern kann auch die Qualität Ihrer Masterarbeit steigern:
- Sie drücken sich präziser aus
- Sie demonstrieren sprachliche Reflexionsfähigkeit
- Sie zeigen Aktualität und Zeitgemäßheit
- Sie vermeiden unbewusste Stereotypisierungen
Fazit: Balance zwischen Lesbarkeit und Inklusion
Gendergerechte Sprache in der Masterarbeit ist ein Balanceakt zwischen Lesbarkeit und inklusiver Ausdrucksweise. Mit etwas Übung und Kreativität gelingt es jedoch, wissenschaftlich präzise und gleichzeitig geschlechtergerecht zu formulieren.
Wichtig ist vor allem Konsistenz: Entscheiden Sie sich für eine Methode und wenden Sie diese durchgängig an. So tragen Sie zu einer respektvollen und inklusiven Wissenschaftssprache bei, ohne den Lesefluss unnötig zu beeinträchtigen.
Die Masterarbeit ist ein guter Anlass, sich mit gendergerechter Sprache vertraut zu machen – eine Kompetenz, die auch im späteren Berufsleben zunehmend geschätzt wird.