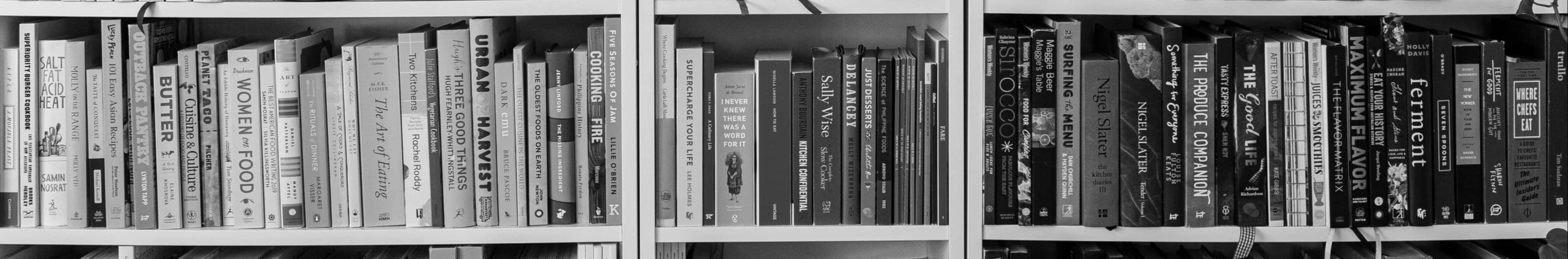Wissenschaftliche Texte folgen einem spezifischen Sprachstil, der sich deutlich von anderen Textformen wie journalistischen Artikeln, literarischen Werken oder Alltagssprache unterscheidet. Dieser besondere Stil dient nicht nur der Tradition, sondern erfüllt wichtige Funktionen für die Wissenschaftskommunikation. In diesem Artikel erfahren Sie, was den wissenschaftlichen Sprachstil auszeichnet, welche Regeln zu beachten sind und wie Sie Ihren eigenen wissenschaftlichen Schreibstil entwickeln können.
Merkmale des wissenschaftlichen Sprachstils
Der wissenschaftliche Sprachstil zeichnet sich durch mehrere charakteristische Merkmale aus, die ihn von anderen Sprachformen unterscheiden:
Objektivität und Sachlichkeit
Wissenschaftliche Texte streben nach größtmöglicher Objektivität. Persönliche Meinungen, emotionale Ausdrücke oder subjektive Wertungen haben in wissenschaftlichen Arbeiten keinen Platz. Die Sachlichkeit wissenschaftlicher Texte zeigt sich in:
- Neutraler Ausdrucksweise ohne wertende Adjektive
- Verzicht auf Ausrufe, rhetorische Fragen oder emotionale Appelle
- Klarer Trennung von Fakten und Interpretationen
- Zurückhaltung bei persönlichen Einschätzungen
Während journalistische Texte oft bewusst emotionale und bildhafte Sprache verwenden, um Aufmerksamkeit zu wecken, zielt der wissenschaftliche Stil auf nüchterne Darstellung und logische Argumentation ab.
Präzision und Exaktheit
Ein zentrales Merkmal wissenschaftlicher Texte ist ihre sprachliche Präzision. Jeder Begriff muss exakt das bezeichnen, was gemeint ist. Diese Genauigkeit wird erreicht durch:
- Verwendung von klar definierten Fachbegriffen
- Eindeutige Begriffsbestimmungen
- Konsequente Verwendung derselben Begriffe für dieselben Sachverhalte
- Vermeidung von Mehrdeutigkeiten und vagen Formulierungen
Komplexität und Sprachdichte
Wissenschaftliche Texte weisen oft eine höhere Informationsdichte auf als andere Textformen. Komplexe Sachverhalte werden in prägnanter Form dargestellt, was sich in folgenden Merkmalen äußert:
- Längere, teilweise verschachtelte Sätze
- Häufige Verwendung von Fachterminologie
- Verdichtete Informationen durch attributive Konstruktionen
- Komplexe Satzstrukturen mit logischen Verknüpfungen
Unpersönlicher Stil
In wissenschaftlichen Texten tritt die Person des Verfassers meist in den Hintergrund. Dies äußert sich in:
- Vermeidung der Ich-Form (mit Ausnahmen in bestimmten Textpassagen)
- Häufige Verwendung passiver Konstruktionen
- Nutzung unpersönlicher Formulierungen ("Es wird festgestellt", "Daraus ergibt sich")
- Formulierungen in der dritten Person
Journalistische Texte hingegen, besonders Reportagen oder Features, beziehen die Person des Autors oft bewusst ein und nutzen die Ich-Perspektive, um Authentizität zu vermitteln.
Nominalstil
Im wissenschaftlichen Sprachstil findet sich häufig eine Tendenz zum Nominalstil, bei dem Substantive anstelle von Verben verwendet werden:
- Substantivierung von Verben (z.B. "Durchführung" statt "durchführen")
- Gebrauch von Funktionsverbgefügen (z.B. "zur Anwendung kommen" statt "anwenden")
- Häufige Verwendung von Substantiven mit den Endungen -ung, -heit, -keit, -ion
Der Nominalstil kann allerdings die Lesbarkeit erschweren und sollte daher nicht übermäßig eingesetzt werden.
Unterschiede zum journalistischen Sprachstil
Der wissenschaftliche Sprachstil unterscheidet sich in mehreren Punkten grundlegend vom journalistischen Stil:
| Wissenschaftlicher Stil | Journalistischer Stil |
|---|---|
| Präzision und Exaktheit | Vereinfachung und Zuspitzung |
| Hoher Fachsprachenanteil | Allgemeinverständliche Sprache |
| Komplexe Satzstrukturen | Kurze, prägnante Sätze |
| Unpersönliche Darstellung | Oft persönliche Darstellung |
| Strenge logische Strukturierung | Aufmerksamkeitsorientierte Strukturierung |
| Extensive Quellenangaben | Selektive Quellenangaben |
| Theoretische Tiefe | Praktische Relevanz |
Journalistische Texte müssen ein breites Publikum ansprechen und folgen dem Prinzip der "umgekehrten Pyramide", bei der die wichtigsten Informationen am Anfang stehen. Sie verwenden bewusst Stilmittel wie bildhafte Sprache, Metaphern oder emotionale Appelle, um Aufmerksamkeit zu wecken. Wissenschaftliche Texte hingegen richten sich an ein Fachpublikum und folgen einer stringenten Argumentationslogik.
Praktische Regeln für wissenschaftliches Schreiben
Um einen angemessenen wissenschaftlichen Sprachstil zu entwickeln, sollten folgende Regeln beachtet werden:
1. Präzise Wortwahl
Wählen Sie Ihre Begriffe mit Bedacht und definieren Sie zentrale Fachbegriffe klar. Verwenden Sie Fachterminologie, wo sie angebracht ist, aber vermeiden Sie übermäßigen "Fachjargon", der die Verständlichkeit beeinträchtigt.
2. Sachlichkeit wahren
Formulieren Sie neutral und vermeiden Sie wertende Ausdrücke. Statt "diese hervorragende Theorie" ist "diese Theorie" angemessener. Subjektive Einschätzungen sollten immer durch Belege oder Argumente gestützt werden.
3. Nominalstil dosieren
Obwohl der Nominalstil für wissenschaftliche Texte charakteristisch ist, sollte er nicht überstrapaziert werden. Ein übermäßiger Nominalstil ("die Durchführung der Untersuchung erfolgte unter Anwendung der beschriebenen Methode") kann durch aktivere Formulierungen ("die Untersuchung wurde mit der beschriebenen Methode durchgeführt") lesbarer gestaltet werden.
4. Satzlänge variieren
Wissenschaftliche Texte neigen zu längeren Sätzen, doch zu komplexe Satzgebilde erschweren das Verständnis. Wechseln Sie daher zwischen längeren und kürzeren Sätzen ab und achten Sie auf eine klare syntaktische Struktur.
5. Füllwörter vermeiden
Verzichten Sie auf Füllwörter wie "eigentlich", "natürlich" oder "gewissermaßen", die keinen inhaltlichen Mehrwert bieten. Wissenschaftliche Texte sollten informationsdicht sein und jedes Wort sollte einen Zweck erfüllen.
6. Konsistenz wahren
Verwenden Sie Begriffe, Abkürzungen und Fachterminologie konsistent. Ein Konzept sollte im gesamten Text immer mit demselben Begriff bezeichnet werden, um Verwirrung zu vermeiden.
7. Metaphern sparsam einsetzen
Während Metaphern und bildhafte Sprache in journalistischen Texten häufig verwendet werden, sollten sie in wissenschaftlichen Arbeiten nur sparsam und mit Bedacht eingesetzt werden, etwa um komplexe Sachverhalte zu veranschaulichen.
Typische Fehler im wissenschaftlichen Schreibstil
Bei wissenschaftlichen Arbeiten werden häufig folgende sprachliche Fehler gemacht:
Übermäßige Verwendung von Fremdwörtern
Fachbegriffe sind wichtig, doch die bloße Anhäufung von Fremdwörtern verbessert einen Text nicht. Fremdwörter sollten nur dann verwendet werden, wenn sie präziser sind als deutsche Begriffe.
Zu starker Nominalstil
Ein übermäßiger Nominalstil ("zur Durchführung der Analyse kam die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse zur Anwendung") macht Texte schwer lesbar und sollte zugunsten aktiverer Formulierungen reduziert werden.
Umgangssprache und Floskeln
Floskeln wie "wie bereits erwähnt" oder umgangssprachliche Wendungen wie "es ist klar, dass" haben in wissenschaftlichen Texten nichts zu suchen und sollten vermieden werden.
Verallgemeinerungen
Absolute Aussagen wie "immer", "nie" oder "alle" sollten vermieden werden, da sie selten wissenschaftlich haltbar sind. Präzisere Formulierungen wie "in der Mehrzahl der Fälle" oder "tendenziell" sind vorzuziehen.
Überkomplexe Sätze
Zu lange und verschachtelte Sätze mit mehreren Nebensätzen erschweren das Verständnis und sollten in mehrere kürzere Sätze aufgeteilt werden.
Die Entwicklung eines eigenen wissenschaftlichen Schreibstils
Der wissenschaftliche Schreibstil entwickelt sich nicht von selbst, sondern erfordert bewusste Übung und Reflexion. Folgende Strategien können dabei helfen:
Vorbilder studieren
Lesen Sie wissenschaftliche Texte in Ihrem Fachgebiet mit besonderem Augenmerk auf sprachliche Besonderheiten. Achten Sie auf Formulierungen, die Ihnen besonders präzise oder elegant erscheinen, und integrieren Sie diese in Ihren eigenen Wortschatz.
Eigene Texte überarbeiten
Überprüfen Sie Ihre Texte auf typische Fehler und sprachliche Schwächen. Lesen Sie Ihre Texte laut vor, um holprige Formulierungen zu erkennen.
Feedback einholen
Lassen Sie Ihre Texte von Kommilitonen, Dozenten oder professionellen Lektoren gegenlesen. Externe Rückmeldungen helfen, blinde Flecken in Ihrem Schreibstil zu erkennen.
Systematischen Wortschatz aufbauen
Legen Sie eine Sammlung gelungener wissenschaftlicher Formulierungen an, die Sie in Ihren eigenen Texten verwenden können. Notieren Sie sich treffende Fachbegriffe und präzise Ausdrücke aus Ihrer Fachliteratur.
Fazit: Balance zwischen Wissenschaftlichkeit und Verständlichkeit
Ein guter wissenschaftlicher Sprachstil zeichnet sich nicht nur durch Präzision, Sachlichkeit und logische Struktur aus, sondern auch durch Verständlichkeit und Lesbarkeit. Die Kunst besteht darin, komplexe Sachverhalte präzise, aber dennoch nachvollziehbar darzustellen.
Wissenschaftliches Schreiben erfordert einen Balanceakt: Einerseits muss der Text den formalen Anforderungen des wissenschaftlichen Diskurses entsprechen, andererseits soll er für die Zielgruppe verständlich bleiben. Mit Übung und bewusster Reflexion kann jeder Studierende einen angemessenen wissenschaftlichen Schreibstil entwickeln, der sowohl präzise und sachlich als auch lesbar und verständlich ist.